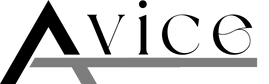Für manche sind sie ein Hoffnungsträger: Manganknollen, die vor allem im Pazifik dicht an dicht auf dem Meeresboden liegen. Ihr Abbau könnte wichtige Rohstoffe etwa für E-Autos liefern – birgt aber auch Gefahren.
Sie liegen wie Pflastersteine in mehreren tausend Metern Tiefe. Polymetallische Knollen, die Mangan, Kupfer, Nickel und Kobalt enthalten. Rohstoffe, die für die Elektromobilität und den Ausbau der Windenenergie immer wichtiger werden. Christian Müller, Leiter der Abteilung Marine Rohstofferkundung bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, kurz BGR, ist in Deutschland sicher einer der besten Kenner der Materie.
Die BGR war schon mehrmals auf Erkundungstour in der Clarion-Clipperton-Zone zwischen Hawaii und Mexiko, wo die Knollen unter anderem lagern und Deutschland ein Lizenzgebiet hat. Mit 4,5 Millionen Quadratkilometern ist das Gesamtgebiet etwa so groß wie die Europäische Union.
Deutschland als Mahner
Weil die Internationale Meeresbodenbehörde als Verwalterin dieser Zone noch keine Regularien für den Tiefseebergbau festgelegt hat, konnten die Länder und Konzerne bisher nur forschen und nichts ernten: “Wir könnten damit in Deutschland den Kupferbedarf zu sechs Prozent, den Nickelbedarf zu 51 Prozent und den Kobaltbedarf zu 80 Prozent decken”, sagt Müller, dessen Einrichtung zum Bundeswirtschaftsministerium gehört, mit Blick auf die Zukunft.
Deutschland würde unabhängiger vom Kongo und von China. Doch trotz dieser Vorteile hat sich die Bundesrepublik für ein Moratorium beziehungsweise eine vorsorgliche Pause beim Tiefseebergbau ausgesprochen, weil die Konsequenzen für die Umwelt noch nicht ausreichend untersucht seien. Dieser Haltung haben sich mehr als 20 ISA-Mitgliedsstaaten und einige große Unternehmen wie BMW, Google, Samsung und Volvo angeschlossen.
Ein Eimer voller Manganknollen. Welche Metalle sich an der Knolle festsetzen, ist von Region zu Region verschieden.
Japan als stiller Treiber und Profiteur
Wie Deutschland ist Japan ein rohstoffarmes Land, allerdings haben Wissenschaftler von JAMSTEC, das ist die japanische Agentur für maritime und geologische Wissenschaft und Technologie, in der eigenen Wirtschaftszone Seltenenerdenschlamm entdeckt. Yoshihisa Kawamura ist Teamleiter des Projekts und sagt ein bisschen schelmisch lächelnd: “Wenn wir diese Elemente aus dem Sediment heben, sind das sehr gute Bodenschätze für Japan.”
Zwar sei es technisch schwierig, in Tiefen von bis zu 5.000 Metern vorzudringen, aber es gab bereits Versuche mit einem entsprechenden Rohr, um die schätzungsweise 12 Millionen Tonnen vom Meeresboden hochzuholen. Japan könnte damit nach Angaben von Kawamura seinen Bedarf an Rohstoffen für Elektrofahrzeuge und Windkraftwerke für Jahrzehnte decken und sogar noch andere Staaten beliefern.
Damit es bald richtig losgehen kann, hat die japanische Regierung im Nachtragshaushalt weitere Forschungsgelder bereitgestellt. Auch Japan will unabhängiger von China werden, von wo es bisher die Seltenen Erden bezieht.
Wie Deutschland hat Japan Lizenzen in der Clarion-Clipperton-Zone, unterstützt aber kein Moratorium. Ein einheimisches Unternehmen hat sich zudem bereits ein Exklusivrecht auf die Verarbeitung der ersten 1,3 Millionen Tonnen Manganknollen gesichert. Dafür hat die Firma eine verbindliche Absichtserklärung mit dem kanadischen Bergbauunternehmen Metals Company geschlossen, dem kommerziellen Treiber des Tiefseebergbaus.
Königreich Tonga zwischen Ablehnung und Hoffnung
Mit der Metals Company beziehungsweise einer Tochter des Unternehmens hat sich auch das Königreich Tonga im Südpazifik zusammengetan. Der Inselstaat will seinen maroden Haushalt dadurch sanieren und tritt als Sponsorstaat auf, um in der Clarion-Clipperton-Zone Manganknollen zu heben.
Sollte das den Fischern zu mehr Einkommen verhelfen, hält es Fischer Roy Panni für eine gute Idee, “ansonsten sollten wir es lieber bleiben lassen”. Sam Feao ist Vorsitzender des Fischereiverbandes und fürchtet um den Fischbestand seines Landes, eine der wichtigsten Einnahmequellen.
Dazu gehören neben der Fischerei auch Walbeobachtungstouren. Doch auch die Wale könnten leiden, wenn erst mal – und sei es auch weit entfernt – laute, große Erntemaschinen über den Meeresboden fahren, um die Manganknollen abzuernten. “Wale reagieren sehr empfindlich auf Geräusche und Krach”, sagt Tukia Tatafu, die seit 20 Jahren Walbeobachtungstouren anbietet.
Gegner: Tonga profitiert nicht
Schon 2020 hat das zivilgesellschaftliche Forum Tongas, ein Zusammenschluss von 144 Nichtregierungsorganisationen, einen Bann für den Tiefseebergbau gefordert. Drew Havea ist der Chef. Er fürchtet vor allem Regressansprüche von anderen Pazifikstaaten, wenn sich Sedimentwolken, die beim Abbau entstehen können, auf den Fischbestand auswirken.
Das könnte passieren, wenn die Internationale Meeresbodenbehörde strenge Regeln für den Tiefseebergbau festlegt. Zudem sei der Tiefseebergbau nicht nachhaltig: “Wenn die Manganknollen einmal gehoben sind, hat Tonga davon gar nichts mehr, die Verarbeitung findet anderswo statt, es werden keine Arbeitsplätze geschaffen.”
Befürworter: Tonga hat keine Alternative
Dem widerspricht der Chef des Geologischen Dienstes von Tonga und Staatssekretär im Ministerium für Land und natürliche Ressourcen, Taaniela Kula, nicht. Er betrachtet den Tiefseebergbau einfach als Chance für die 100.000 Einwohner seines Landes: “Wir haben keinen anderen Bereich, der unsere Wirtschaft stärken kann. Der Tourismus kommt nicht infrage, wir haben nur ein paar hundert Hotelbetten, können keine internationale Konferenz abhalten. Also müssen wir uns einem Sektor zuwenden, der unsere Wirtschaft voranbringt, und die Mineralien auf dem Meeresboden haben das Potential dafür.”
Tonga werde von jeder gehobenen Tone Manganknollen 2,50 US-Dollar erhalten, und jährlich könnten bis zu drei Millionen Tonnen gehoben werden, sagt Kula.
Einfluss auf Umwelt umstritten
Der Einfluss auf die Umwelt hält er für minimal. Das sieht Lina Taulani ähnlich. Die Umwelttechnikerin war zwei Mal auf Erkundungsreise in der Clarion-Clipperton-Zone und hat dort, finanziert von der kanadischen Metals Company, unter anderem Sedimentproben genommen. Sie sagt: Anders als oft behauptet, würden sich Sedimentwolken, die beim Abbau entstehen können, nicht kilometerweit bewegen, sondern nur 20 Meter vom Meeresboden in die Höhe gehen, dann aber von der Schwerkraft wieder nach unten gedrückt werden. Das hätten sie anhand von ferngesteuerten Fahrzeugen und durch Sensoren im Testfeld festgestellt.
Befürworter und Kritiker haben inzwischen unzählige Studien vorgelegt, noch ist nicht entschieden, wer sich am Ende durchsetzen wird. Nach der Frühjahrsitzung der ISA folgt eine weitere im Sommer. Dann könnten die ersten Regularien festgelegt werden.